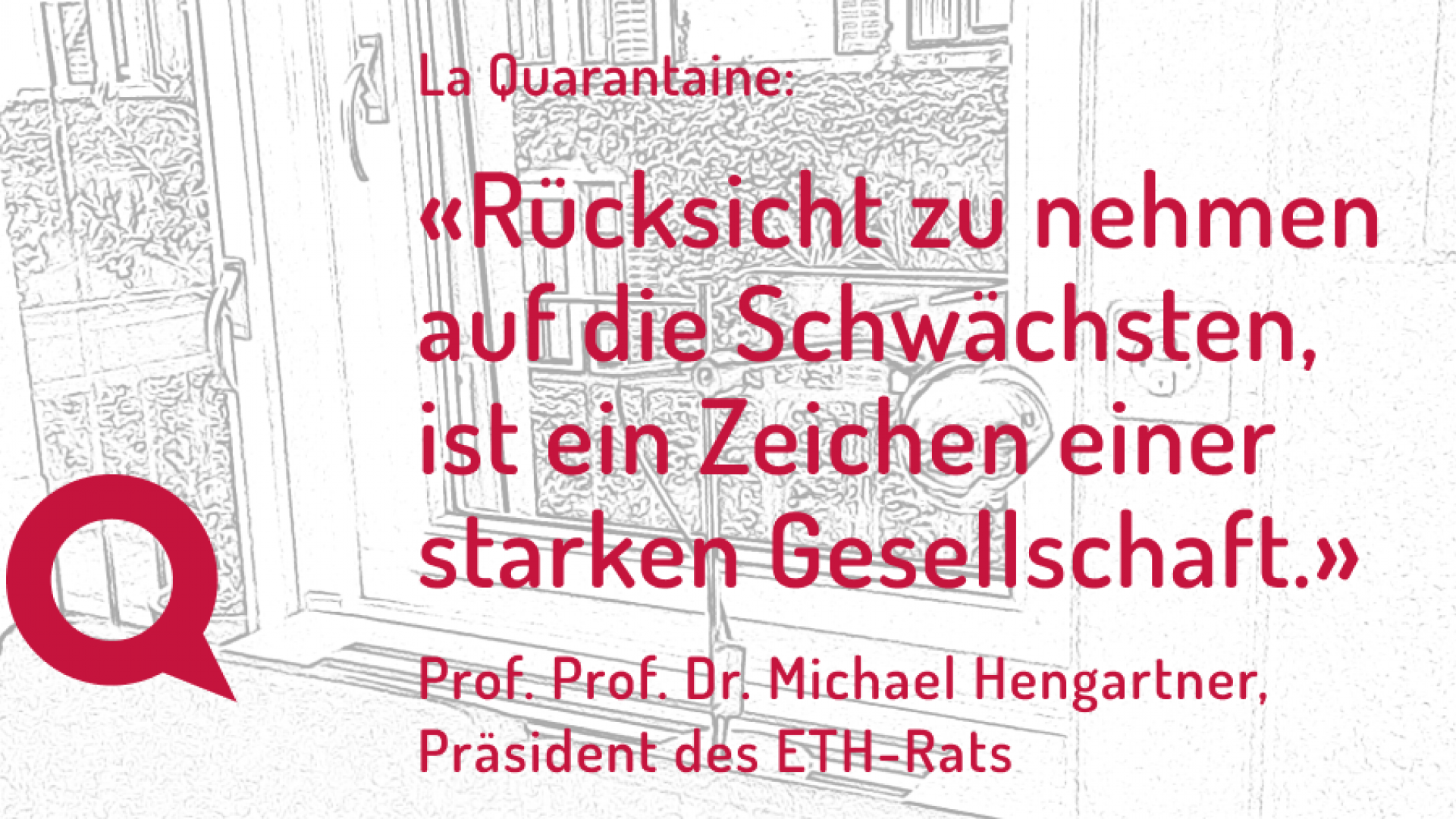
Um die Corona-Krise zu bewältigen, setzt der Präsident des ETH Rats, Prof. Dr. Michael Hengartner, auf die Kraft des Gemeinsinns – auf gesellschaftlicher wie auch auf politischer Ebene. Als ehemaliger Rektor der Universität Zürich hat er beruflich eine akute Krise durchlebt. Er berichtet uns davon, wie er neue Strukturen und Prozesse etablierte, die auch über die Krise hinaus Wirkung entfaltet haben. Mit Blick auf das Bildungswesen hofft er, dass die Hochschulen in Zukunft auf die Erfahrungen der rasanten digitalen Umstellung zurückgreifen können, die momentan stattfindet.
Prof. Dr. Michael O. Hengartner ist seit Anfang Februar Präsident des ETH Rats. Von Februar 2014 bis Januar 2020 war er Rektor der Universität Zürich (UZH). Von 2016 bis zu seinem Ausscheiden als UZH-Rektor amtete er zudem als Präsident von swissuniversities.
Teil 1 - Alltag unter Corona
Die Standesdünkel fallen weg. Die Menschen nehmen ihre persönlichen Anliegen stark zurück, um für die Gemeinschaft zu handeln.
Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die Corona-bedingte ausserordentliche Lage?
Mit einer Mischung aus Sorgen und Aufbruchstimmung. Sorgen um die Gesundheit der Menschen, die ich persönlich kenne, sowie um die Gesundheit von schwachen Menschen. Aber auch Sorgen um Personen, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist oder beschädigt wird. Andererseits habe ich in den letzten Wochen auch sehr viele positive Erfahrungen gemacht: Die Beobachtung, wie flexibel wir Menschen uns umstellen und neu einarbeiten können, wie schnell wir zusammenkommen und diese Herausforderung gemeinsam angehen können. Oder auch, wie überraschend gut Kinder von einen Tag auf den anderen gelernt haben, Distanzregeln einzuhalten und die Situation zu meistern. Nebst den Sorgen bin ich positiv beeindruckt von der Resilienz der Menschheit.
Wie beeinflusst diese Situation Ihre Arbeit im ETH-Rat?
Der ETH-Rat hat den grossen Vorteil, dass wir sehr schnell dezentral arbeiten konnten, da wir keine Forschung betreiben. Noch bevor der Bundesrat die Massnahme der Telearbeit beschlossen hat, sind wir freiwillig auf Home Office umgestiegen, um beizutragen, die Dichte im ÖV und den Kontakt zu anderen Menschen zu reduzieren. Aber auch für uns bedeutet dies eine neue Art des Arbeitens. Unsere Kolleginnen und Kollegen fehlen uns. Im Vorfeld des Osterwochenendes haben wir zum ersten Mal seit dem Lockdown einen Videocall abgehalten mit allen 50 Teammitgliedern. Wir konnten zwar keine Schoggi-Hasen verteilen. Aber uns zumindest sehen und austauschen zu können, war schön.
Eine gewisse Gelassenheit und Weitsicht hilft. Die Menschheit hat schon ganz andere Herausforderungen überstanden.
Wie hat sich die Zusammenarbeit mit externen Akteuren verändert, die sich jetzt auch reorganisieren mussten?
Haben sich auch neue Allianzen ergeben? Als Ratspräsident bin ich strategisch tätig, und versuche zu koordinieren. Zum Glück kenne ich wichtige Ansprechpersonen universitärer Institutionen aus früheren Tätigkeiten. Wir haben eine Taskforce etabliert, um zu evaluieren, wie man das wissenschaftliche Knowhow gemeinsam zur Verfügung stellen kann. Bis jetzt hat das sehr gut funktioniert und man spürt einen enormen Willen von allen Beteiligten, sich einzusetzen und Hilfe zu leisten, sofern man kann. Wir haben bereits viel Erfahrung mit solchen Situationen, aber mir ist aufgefallen, dass dieses Mal die Standesdünkel wegfallen. Auch nehmen die Leute ihre persönlichen Anliegen stark zurück, um für die Gemeinschaft zu handeln.
Was gibt Ihnen persönlich Kraft und Halt in schwierigen Situationen?
Ich habe das Glück, ein unterstützendes Umfeld zu haben, mit einem grossartigen Team auf der Arbeit sowie einer wunderbaren Frau und vier Kindern Zuhause. Auch eine gewisse Gelassenheit und Weitsicht hilft. Die Menschheit hat schon ganz andere Herausforderungen überstanden und Schlimmeres durchgemacht, deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch diese Krise meistern werden: «Also this shall pass»:
Was lesen Sie gerade?
Mit meiner ältesten Tochter lese ich gerade «Drei Schwestern» von Anton Tschechow als Teil ihrer Französischaufgaben. Das können wir inhaltlich besprechen und lernen zugleich noch etwas Französisch. Ich selbst lese «A Short History of Nearly Everything» von Bill Bryson – auch wenn es leider gar nicht so kurz ist. Aber das Buch ist humorvoll und bereitet mir viel Spass. Auch in der Arbeit habe ich sehr viel Lektüre. Übers Wochenende las ich das ETH-Gesetz. Etwas trockener, ja, aber auch sehr informativ.
Welche ist zurzeit Ihre Lieblingsecke im Haus?
Wir haben eine wunderbare, grosse Terrasse mit Blick auf unseren Garten, auf den Irchel und aufs Glatttal bis nach Deutschland. Ich bin sehr gern dort draussen, weil man dort Weitsicht hat – das hilft, um abzuschalten, oder um sich ein grösseres Gesamtbild zu verschaffen.
Womit beschäftigen Sie sich zurzeit oder was haben Sie noch vor?
Ich bin etwas mehr im Garten als sonst. Auf meiner To-Do-Liste steht zudem noch Italienisch lernen. Dazu bin ich noch nicht gekommen, habe es aber fest vor.
Wecker oder Ausschlafen? Ausschlafen. Wobei das Rascheln meiner Tochter, eine natürliche Frühaufsteherin, mich ganz sanft wie Vogelgezwitscher weckt, ein organischer Wecker also.
Selber einkaufen oder einkaufen lassen? Wir machen das als Familie und kaufen weiterhin selbst ein. Zwar bestellen wir etwas mehr im Internet als üblich, aber hauptsächlich deshalb, weil man diese Produkte nicht mehr im Laden kaufen kann.
Erhöhter oder reduzierter Medienkonsum? Erhöhter Medienkonsum. Da verlasse ich mich aber auf meine Frau, sie zeigt mir alles, was interessant ist.
Twitter oder kein Twitter? Selber bin ich zwar ein sehr moderater Twitterer, allerdings schaue ich sehr gerne, was auf Twitter publiziert wird.
Video-Call oder Telefon? Beides. Mit Bekannten nutze ich gerne Videocalls, das ist persönlicher. Ein normaler Anruf ist aber manchmal schneller, weil man es nicht im Voraus organisieren muss.
Netflix oder Tolstoi? Eher Tolstoi, wobei wir uns als Familie gerade durch die ganze Star Trek-Serie durchschauen.
Fünf-Gänger oder Dosen-Ravioli? Dosen-Ravioli nicht gerade, aber schon eher einfache Gerichte. Heute Mittag gab es zum Beispiel selbst gemachte Pizza.
Home-Fitness oder Spaziergang im Wald? Wir haben das Glück, zwischen dem Zürichbergwald und dem Irchelpark zu wohnen – somit gehen wir sehr gerne in den Park oder den Wald spazieren.
Teil 2 - Erfahrungen mit Krisensituationen
Meine Krisenerfahrung hat gezeigt, dass man nie wirklich zum Status Quo zurückkehrt.
Was für Krisen haben Sie in Ihrem Berufsleben bereits erlebt?
Eine Krise, die ich knapp verpasst habe, aber die Konsequenzen auf mein Berufsleben hatte, war 9/11. Anfangs 2001 zügelte ich meine Forschungsgruppe von Long Island in New York nach Zürich. Zur Zeit des Anschlags befanden sich immer noch einige Mitarbeitende meines Labors auf Long Island. Ich erinnere mich an den Moment, als ich hier in der Schweiz gesehen habe, wie der zweite Turm einstürzte. Da habe ich beschlossen, das Labor für den Rest des Tages zu schliessen und trat unmittelbar mit unseren Leuten vor Ort in Kontakt. Operationell hat sich zwar relativ schnell alles wieder normalisiert, aber die Psyche war bei vielen Mitarbeitenden angeschlagen. Es war eine dramatische Erfahrung, auch weil man betroffene Menschen persönlich kannte. In New York konnte man den Rauch nicht nur sehen, sondern auch riechen.
Wie sind Sie damit umgegangen, aus der Ferne das Trauma der Menschen vor Ort mitzuerleben?
Unsere Mitarbeitenden waren sehr erschüttert und konnten nicht so schnell in den Alltag zurückkehren, also mussten wir ein gewisses Verständnis aufbringen, dass Forschungsprojekte etwas länger brauchen würden als ursprünglich geplant. Mit der Zeit hat sich das normalisiert, denn das Labor befand sich nicht direkt in Manhattan, wo die Menschen natürlich noch viel mehr betroffen waren. In unserem dorfähnlichen Forschungslabor, etwa 40 Kilometer entfernt, konnte man sich gegenseitig unterstützen.
Sie haben noch eine weitere Krise erlebt, gerade bei Ihrem Stellenwechsel.
Ja, das war eine ganz andere Art von Krise. Ich hatte das Amt des Rektors an der Universität Zürich frühzeitig übernommen, da mein Vorgänger per sofort zurückgetreten war - in Folge der Wirrungen um das medizinhistorische Institut [Die Affäre um die Entlassung von Christoph Mörgeli als Leiter des medizinhistorischen Museums, Anmerkung der Redaktion]. Das war für die Universität eine schwierige Zeit. Wir waren sehr sichtbar und wurden von den Medien und der Politik genau beobachtet.
Wichtig war, gegen aussen und innen aktiv zu kommunizieren, dass man den Ernst der Lage und die Herausforderungen erkannt hatte, und diese jetzt anging.
Der Stellenwechsel erfolgte also auf dem Höhepunkt der Krise, die ganze Aufmerksamkeit war auf Sie als Nachfolger gerichtet. Wie sind Sie vorgegangen, um Ruhe zu schaffen und wieder Vertrauen in die Institutionen zu bringen?
Wir haben sehr schnell, sehr proaktiv kommuniziert. Das Erste, das ich gesagt habe, war, dass wir Fehler gemacht haben. Dass wir unsere Schwachstellen identifizieren und diese mit entsprechenden Schritten angehen. Auch mussten wir sehr schnell nach innen kommunizieren, weil Mitarbeitende und Angehörige der Hochschule verunsichert waren – vor allem diejenigen, die nach aussen sichtbar waren. Wichtig war also, gegen aussen und innen aktiv zu kommunizieren, dass man den Ernst der Lage und die Herausforderungen erkannt hatte, und diese jetzt anging.
Wie hat sich ihr Krisenmanagement dadurch verändert?
Wir haben die Leiter der Kommunikations- und Rechtsabteilung als ständige Gäste in die Sitzungen der Universitätsleitung eingeladen. Somit konnten wir bei wichtigen Fragen diskutieren und abschätzen, welche kommunikativen und juristischen Konsequenzen eine neue Situation haben könnte. Das bedeutete auch, dass wir diese zwei wichtigen, formalen Elemente direkt in den Entscheidungsfindungsprozess miteinbeziehen konnten, auch wenn sie nicht unbedingt mit dem Inhalt zu tun hatten. Durch die strategische Verwendung von Kommunikationskanälen sowie regelmässigen Treffen mit Medienkontakten und der Politik wollte ich auch zeigen: «Ich bin da und setze mich ein, um das Vertrauen wiederherzustellen.»
Haben Sie nach der Krise den Kontakt mit den Medien strukturell weitergepflegt?
Ja, es war wichtig, diese Medienkontakte zu institutionalisieren, denn nach der Krise ist vor der Krise. Gerade bei einer Institution von der Grösse der Universität Zürich lautet die Frage nicht ob, sondern wann es wieder «klöpfen» wird. Deshalb muss man gut vorbereitet sein, um schnell und effizient reagieren zu können. Nebst Medienkonferenzen organisierten wir zum Beispiel ein regelmässiges Medienfrühstück, bei dem es keine konkrete Agenda gab, sondern die Journalistinnen und Journalisten einfach mal fragen konnten, was sie gerade interessierte. Dort lernten wir und die Medienschaffenden uns gegenseitig kennen. Auch die Pflege der Beziehungen zur Politik waren wichtig. Ich hatte regelmässigen Austausch mit den Fraktionen im Kantonsrat und mit den für uns relevanten Kommissionen. Das erlaubte ein besseres Verständnis für das spezielle institutionelle Gebilde Universität.
Wir haben aus den Fehlern gelernt und uns für die Zukunft besser aufgestellt.
Gab es während der Krise, als sehr viel sehr schnell passiert ist, im Tagesablauf gewisse Dinge oder Personen, die Ihnen geholfen haben?
Anders als bei einem Notfall oder einem Blaulichtevent muss man bei solchen Kommunikationskrisen weniger stark unter Zeitdruck arbeiten und eine Entscheidung nicht innerhalb von 15 Minuten fällen. Medienanfragen konnten wir in der Regel am nächsten Tag beantworten, was uns Zeit gab, uns abzustimmen. In der Tat brauchte es sehr viel Koordination: mit der Universitätsleitung, mit der Professorenschaft, mit den Dekanen, mit der Kommunikationsabteilung.
Welche Elemente einer Krise und des Krisenmanagements unterschätzt man als Aussenstehende?
Alle komplexen Institutionen wie eben Universitäten verfügen über gewisse Rahmenbedingungen, in denen sie sich bewegen müssen, die aber für Aussenstehende nicht immer ersichtlich sind. Zum Beispiel waren viele Personen der Ansicht, ein Rektor könne wie ein CEO einer Firma entscheiden. Doch die Universitätsleitung ist ein Kollegialorgan, es braucht gemeinsame Entscheidungen. Dass diese Rahmenbedingungen oft nicht klar ersichtlich sind, macht es schwer, von aussen Schritte nachzuvollziehen oder zu verstehen, warum es bis zu einer Entscheidung eher lange gedauert hat.
Was für ein Fazit ziehen Sie aus diesen zwei Krisen?
Beide Krisen haben gezeigt, dass man nie wirklich zum Status Quo zurückkehrt. Sie haben langfristige Spuren hinterlassen, positive sowie negative. Bei der Universität Zürich hat dies sicher dazu geführt, dass wir aus den Fehlern gelernt und uns für die Zukunft besser aufgestellt haben. Wir haben die Krise auch genutzt, um Diskussionen über Gouvernance zu führen. Es war ein guter Moment, um uns weiterzuentwickeln und hat auch eine Aufbruchstimmung generiert.
Teil 3 - Konkrete Folgen der Corona-Krise für die Wissenschaft
Digitales Lernen sowie eine Reduktion von Flügen sind möglich, aber die Universität als Begegnungsort werden wir nicht abschaffen.
Zurück zur aktuellen Corona-Krise: Wie wird Ihrer Meinung nach diese Krise die Wissenschaft verändern?
Wir sehen jetzt, dass Dinge wie flächendeckendes digitales Lernen möglich sind. Das haben wir vorher nur punktuell erprobt. Viele waren skeptisch, ob das funktionieren würde. Nun bin ich gespannt auf die Analyse, die zeigen wird, was bei der Umstellung auf digitales Lernen gut gelaufen ist und was man noch besser machen kann. Ich glaube, dass hier enorm viel Potential besteht und wir müssen uns nun fragen, was wir in Zukunft digital machen wollen. Gleichzeitig möchten wir, dass die Universität weiterhin ein Ort der Begegnung bleibt, weil Lernen in der Interaktion stattfindet. Abschaffen wollen wir die Universität nicht, aber schneller und breiter auf digitale Instrumente zurückzugreifen.
Was wäre ein gutes Mass zwischen digitalem Lernen und physischem Beisammensein?
Wenn es um das Mitteilen von Wissen geht, kann man das gut digital tun. Wenn es aber um die Vermittlung von Kompetenzen geht, oder um das Reflektieren, dann funktioniert das wohl besser gemeinsam mit anderen Menschen. Auch spielt die jeweilige Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien eine grosse Rolle: Je komfortabler man damit ist, desto mehr kann und will man digital lernen. Das heisst aber, dass man bereits in der Schule ansetzen muss und Schülerinnen und Schüler an die Nutzung digitaler Tools heranführen sollte. Je autonomer die Schüler in ihrem eigenen Lernprozess werden, desto vertretbarer ist schlussendlich ein «flipped classroom». [Der sogenannte «umgedrehte Unterricht», wo die Wissensvermittlung Zuhause stattfindet und die Anwendung im Unterricht, Anmerkung der Redaktion]
Das Thema Klima wurde kurzeitig verdrängt, es wird aber rasch wieder zurückkommen – als langfristig grösste Herausforderung für unsere Gesellschaft.
Welche weiteren Folgen könnte die Corona-Krise für Ihre Institution haben?
Die Krise zeigt, dass es durchaus möglich ist, auch ohne ständiges Herumjetten in der Welt international zusammenzuarbeiten. Damit haben wir uns lange Zeit enorm schwergetan: Uns war bewusst, dass ein grosser Teil des CO2-Abdrucks unserer Hochschulen durch die Flugbewegungen unserer Mitarbeitenden erfolgt. Wir haben aber immer gesagt, dass das unbedingt nötig ist. Nun zeigt sich: Das stimmt nur bedingt. Ich gehe davon aus, dass in Zukunft weniger geflogen wird und der internationale Austausch vermehrt auch digital stattfinden kann.
Was denken Sie, auf welchem Niveau wird sich das wissenschaftliche Reisen einpendeln?
Ich denke, wir werden ein Fenster haben, in dem die Hochschule als Gemeinschaft entscheiden kann, sich selbst Vorgaben zu geben. Es ist einfacher, sich von einem tiefen Niveau herkommend, einen Plafond zu geben, als von einem hohen Niveau, quasi von oben herab, die Emissionen zu reduzieren. Auch wenn das Thema Klima kurzeitig verdrängt worden ist, wird es dennoch rasch wieder zurückkommen – als langfristig grösste Herausforderung für unsere Gesellschaft. Insofern ist der jetzige Moment ein klassischer Fall von Krise als Chance.
Teil 4 - Langfristige Implikationen der Corona-Krise auf die Gesellschaft
Rücksicht zu nehmen auf die Schwächsten der Gesellschaft ist das Zeichen einer starken Gesellschaft.
Was ist jetzt gesellschaftlich wichtig, um diese Krise langfristig zu bewältigen?
Die Epidemie selbst wird erst dann gebannt, wenn R unter 1 geht und langfristig dort bleibt. Dies geschieht, wenn ein genügend grosser Teil der Bevölkerung immun geworden ist – entweder durch überstandene Ansteckung oder, hoffentlich, durch einen Impfstoff. Für beide Szenarien wird es Monate, im schlimmsten Fall Jahre brauchen. Deswegen benötigen wir jetzt gesellschaftlich neue Verhaltensweisen. Denn wie lange der soziale Druck und die Massnahmen helfen werden, uns richtig zu benehmen, ist ungewiss. Weil wir Menschen alle nicht nur altruistische, sondern auch egoistische Züge haben, ist die Schaffung eines gemeinsamen Durchhaltevermögens sowie eines gewissen Sozialsinns sehr wichtig.
Wo befürchten Sie, dass das Durchhaltevermögen und der Gemeinsinn am ehesten zu bröckeln beginnen könnte?
Bei der sozialen Kohäsion. Je grösser der Teil der Bevölkerung wird, der persönlich Schaden nimmt, gleichzeitig aber nicht den gesellschaftlichen Nutzen der Massnahmen sieht, umso schwieriger wird es werden. Doch Rücksicht zu nehmen auf die Schwächsten der Gesellschaft ist das Zeichen einer starken Gesellschaft.
Welche Massnahmen wären Ihrer Meinung nach wichtig, um die soziale Kohäsion zu fördern?
Wir müssen sicherstellen, dass man denjenigen, die jetzt wirtschaftlich Schaden nehmen, so weit wie möglich entgegenkommt, damit sie merken: «Auch auf mich schaut man». Wenn wir Rücksicht auf alle nehmen, die jetzt unter der Krise leiden, zeigen wir, dass wir eine starke Gesellschaft sind, die bereit ist, gemeinsam diese Herausforderung anzugehen.
Wir müssen uns als Teil einer globalen Herausforderung sehen und uns fragen, wo wir unsere Unterstützung anbieten können.
Haben Sie gewisse Sorgen zu möglichen politischen Folgen dieser Krise?
Es wäre wichtig, in der Krise international zusammenzuarbeiten und zu merken, dass es wenig bringt, wenn nur einzelne Länder ihre Grenzen schliessen und andere unilateral Masken ordern, es aber kaum mehr Lieferungen gibt. Wir brauchen einen staatlichen Gemeinsinn, der sich leider noch nicht herauskristallisiert hat. Gelingt dies nicht, besteht das Risiko, dass jedes Land für sich denkt. So würden Zentrifugalkräfte gestützt, anstatt die Zusammenarbeit gestärkt.
Was kann die Schweiz tun, um eine multilaterale Art von Zusammenarbeit zu fördern und zu verhindern, dass wir isoliert werden?
Als kleines, offenes Land hat die Schweiz immer Interesse an Zusammenarbeit gehabt. Sobald es uns etwas besser geht, müssen wir schauen, dass wir nicht einfach aufatmen und sagen, «das haben wir jetzt hinter uns», sondern dass wir aktiv schauen, wer Hilfe benötigen könnte. Wir müssen uns als Teil einer globalen Herausforderung sehen und uns fragen, wo wir unseren Input und unsere Unterstützung anbieten können. Dies auch im Wissen darum, dass es uns in einer zweiten Welle in vier, fünf Monaten vielleicht wieder schlecht gehen könnte und wir dann ebenfalls über Unterstützung froh sein würden. Wir sollten also mit gutem Beispiel vorangehen.
Zum Schluss: Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn diese Ausnahmesituation vorbei ist?
Beruflich freue ich mich am meisten auf meinen ersten Spaziergang durch die Hochschulen, und darauf, den Lichthof der Uni und den Haupthof der ETH wieder voller Studierenden zu sehen. Es gibt wenig, das ich je so energiefüllend empfunden habe, wie junge Menschen, die Wissensdurst haben und mit Neugierde und Leidenschaft da sind, um etwas zu lernen. Und privat freue ich mich auf ein Tête-à-Tête mit meiner Frau in einem guten Restaurant!
